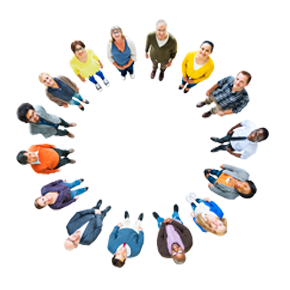- Crowdworker kann Arbeitnehmer sein
- Probezeitkündigung
- Deutsch als Kommunikationssprache mit Betriebsrat nicht zwingend
- Höhe der Entschädigung bei Diskriminierung
- Gesetzliche Kündigungsfrist bei Geschäftsführerdienstverträgen
- Skifahren gehört nicht zu Geschäftsführerpflichten
- Rohertrag keine taugliche Berechnungsgrundlage für Vertragshändlerausgleich
- Zuständigkeit deutscher Gerichte bei Flugbuchungen über das Internet
- Abmahnmissbrauch lohnt sich künftig nicht mehr
- DSGVO Bußgeld
Crowdworker kann Arbeitnehmer sein
Steuert der Auftraggeber (Crowdsourcer) die Zusammenarbeit über die von ihm betriebene Online-Plattform derart, dass der Auftragnehmer (Crowdworker) seine Tätigkeit nach Ort, Zeit und Inhalt nicht frei gestalten kann, spricht dies nach Auffassung des BAG für ein Arbeitsverhältnis (Urteil vom 1.12.2020 – 9 AZR 102/20).
Bei der Beklagten handelt es sich um die Betreiberin einer Online-Plattform, die im Auftrag ihrer Kunden die Präsentation von Produkten im Handel und an Tankstellen überprüft. Dazu greift sie auf Crowdworker zurück, die über die Online-Plattform Aufträge übernehmen können – ohne jedoch vertraglich dazu verpflichtet zu sein. Meldet sich ein Crowdworker für einen Auftrag, so muss er diesen regelmäßig innerhalb einer bestimmten Zeit nach den detaillierten Vorgaben der Beklagten erledigen. Im Gegenzug erhält er „Erfahrungspunkte“ und damit im Laufe der Zeit die Möglichkeit, parallel mehrere Aufträge anzunehmen.
Der Kläger hatte für die Beklagte zuletzt fast 3.000 Aufträge ausgeführt. Aufgrund von Unstimmigkeiten hatte die Beklagte jedoch entschieden, ihm keine weiteren Aufträge mehr anzubieten. Der Kläger beantragte daraufhin vor Gericht die Feststellung, dass zwischen ihm und der Plattformbetreiberin ein unbefristetes Arbeitsverhältnis bestehe.
Das BAG gab dem Kläger Recht: Er sei zwar vertraglich nicht zur Annahme der Aufträge verpflichtet gewesen, die spezifische Organisationsstruktur und das Anreizsystem seien aber darauf ausgelegt, dass der Kläger kontinuierlich in arbeitnehmertypischer Weise weisungsgebundene und fremdbestimmter Arbeit verrichte. Es sei daher im konkreten Fall von einem Arbeitsverhältnis auszugehen.
Ein Crowdworker kann also durchaus als Arbeitnehmer zu qualifizieren sein – es kommt jedoch immer auf die Ausgestaltung der Zusammenarbeit im jeweiligen Einzelfall an.
Kündigung in der Probezeit wegen Krankheit
Zur Frage, ab wann eine Kündigung in der Probezeit aus anderen Gründen, zum Beispiel wegen Diskriminierung oder Schikane, unwirksam sein kann.
Der Arbeitgeber muss eine Kündigung in der Probezeit nicht begründen, denn während der ersten sechs Monate besteht für Arbeitnehmer unabhängig von der Größe des Betriebs kein Kündigungsschutz. Ausnahmsweise kann eine Kündigung in der Probezeit aber dennoch unwirksam sein, wenn dadurch gegen andere Schutzgesetze verstoßen wird, etwa gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz oder das Maßregelverbot nach § 612a BGB.
Ganz so einfach lässt sich eine Kündigung wegen behaupteter Diskriminierung oder Schikane jedoch nicht angreifen, wie ein aktuelles Urteil des LAG Köln (Urteil vom 15.05.2020 – 4 Sa 693/19) zeigt.
Hier hatte der Arbeitgeber einer Arbeitnehmerin nach wiederholter Krankmeldung in der Probezeit ohne Angabe von Gründen gekündigt. Die Arbeitnehmerin behauptete daraufhin, der Arbeitgeber habe wegen ihrer Erkrankung gekündigt und insofern gegen das Diskriminierungsverbot verstoßen. Zudem sei die Kündigung unwirksam, weil der Arbeitgeber sie wegen der Krankmeldung habe maßregeln wollen.
Mit beiden Argumenten kam die Arbeitnehmerin nicht durch. Das LAG Köln stellte zum einen klar, dass vorübergehende Erkrankungen keine Behinderung im Sinne des Antidiskriminierungsrechts seien und daher auch keine Diskriminierung vorliegen kann. Es lag auch keine Schikane vor, denn dies setzt voraus, dass der Arbeitgeber einen Arbeitnehmer maßregeln will, der in zulässigerweise seine Rechte ausübt.
Wer aber arbeitsunfähig erkrankt, übt kein Recht aus, das der Arbeitgeber maßregeln könnte. Der Arbeitnehmer ist, wenn er denn tatsächlich krank ist, außerstande, seine Arbeitsleistung zu erbringen (so schon das BAG, Urteil vom 26.10.1994 – 10 AZR 482/93).
Im Übrigen stellt das Gericht klar, dass es zulässig ist, einem Arbeitnehmer „während einer Erkrankung (oder sogar wegen Erkrankung)“ zu kündigen. Die Probezeit kann also gerade auch zur Überprüfung genutzt werden, ob ein Arbeitnehmer leicht oder häufig erkrankt.
Dennoch empfiehlt es sich, Kündigungen grundsätzlich nicht zu begründen, wenn kein Kündigungsschutz besteht.
Deutsch als Kommunikationssprache mit Betriebsrat nicht zwingend
Der Betriebsrat kann nicht verlangen, dass Gespräche mit dem Vertreter des Arbeitgebers in deutscher Sprache erfolgen und der Vertreter die Sprache versteht – sofern jeweils entsprechende Übersetzungen gewährleistet sind.
Das LAG Nürnberg (Beschluss vom 9.10.2019, Az. 12 BV 31/19) hat herausgestellt, dass der Betriebsrat keinen Anspruch gegen den Arbeitgeber auf Kommunikation allein in deutscher Sprache hat. Im vorliegenden Fall war die in einer der deutschen Filialen eines spanischen Konzerns eingesetzte Filialleiterin zu Beginn ihrer Tätigkeit der deutschen Sprache nur eingeschränkt mächtig. Die Kommunikation fand zunächst vorwiegend auf Englisch statt, eine Übersetzung ins Deutsche war jedoch – nach einer entsprechenden Rüge des Betriebsrats (BR) – sichergestellt.
Das LAG hat entschieden, dass der Betriebsrat keinen Anspruch darauf hat, dass der Arbeitgeber nur auf Deutsch kommuniziert. Es liegen keine wesentlichen Behinderungen der Betriebsratsarbeit oder Einschränkungen der Entfaltungsmöglichkeiten des Betriebsrats vor, wenn gewährleistet ist, dass sämtliche Erklärungen der Filialleiterin in verständlicher Form gegenüber den BR-Mitgliedern abgegeben und die Erklärungen von BR-Mitgliedern gegenüber der Filialleitung entgegengenommen und wahrgenommen werden können. Entscheidend ist, dass die schriftliche oder mündliche Kommunikation in deutscher Sprache beim Betriebsrat ankommt und von den BR-Mitgliedern an die Vertreter des Arbeitgebers auf den Weg gegeben werden kann. Fehler bei der Übersetzung, insbesondere bei mündlichen Erklärungen, gehen zu Lasten des Arbeitgebers.
Dies bedeutet in der Praxis, dass bei Vertretern des Arbeitgebers, die die deutsche Sprache (noch) nicht ausreichend beherrschen, stets eine Übersetzung der Aussagen gegenüber dem Betriebsrat ins Deutsche erfolgen muss. Gleiches gilt für die Kommunikation von Seiten des Betriebsrats. Hier ist durch entsprechende Organisation sicherzustellen, dass der Betriebsrat seine Anliegen in deutscher Sprache vorbringen kann und diese übersetzt an die Vertreter des Arbeitgebers weitergeleitet werden. Perfekte Sprachkenntnisse sind hingegen nicht erforderlich.
Höhe der Entschädigung bei Diskriminierung
Bei einem Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) muss der Arbeitgeber eine Entschädigung zahlen. Auf ein Verschulden kommt es dabei nicht an, so dass mildernde Umstände zugunsten des Arbeitgebers keine Rolle bei der Festlegung der Entschädigungshöhe spielen dürfen (Urteil des BAG vom 28.5.2020, 8 AZR 170/19).
Der Kläger hatte sich bei der Beklagten auf eine ausgeschriebene Stelle beworben. In der Bewerbung wies er deutlich auf seine Schwerbehinderung hin. Da die Beklagte ihn nicht zu einem Vorstellungsgespräch einlud, verlangte der Kläger vor Gericht die Zahlung einer Entschädigung.
Das Landesarbeitsgericht Niedersachsen ging zunächst davon aus, dass die Entschädigung nach dem AGG höchstens 3 Monatsgehälter betragen dürfe und setzte einen Betrag von 1.000,00 € fest. Es begründete dies u.a. damit, dass die Beklagte seit Jahren vorbildlich ihre Pflichten zur Einstellung von schwerbehinderten Menschen erfülle.
Das BAG widersprach dieser Auffassung und legte eine deutlich höhere Entschädigung von 5.100,00 € fest. Es komme nicht auf das Verschulden der Beklagten an, so dass ein respektvolles Verhalten in der Vergangenheit oder ein freundliches Absageschreiben nicht zu einer geringeren Entschädigung führen dürften. Das AGG sehe auch keine Höchstgrenze von 3 Monatsgehältern vor – die Regelung sei lediglich eine „Kappungsgrenze“. Zunächst sei die angemessene Entschädigung festzulegen und erst in einem weiteren Schritt zu prüfen, ob der Betrag ggf. auf 3 Monatsgehälter zu kappen sei. Im vorliegenden Fall entsprach die Entschädigungssumme von 5.100,00 € jedoch lediglich 1,5 Monatsgehältern, so dass eine Kürzung nicht nötig war.
Gesetzliche Kündigungsfrist bei Geschäftsführerdienstverträgen
Nach der jüngsten Rechtsprechung des BAG finden bei Dienstverträgen von GmbH-Geschäftsführern die gesetzlichen Kündigungsfristen für Arbeitsverhältnisse aus § 622 BGB keine Anwendung (Urteil des BAG vom 11.6.2020 – 2 AZR 374/19). Der BGH hatte das bislang anders gesehen und sog. Fremdgeschäftsführer, die nicht Mehrheitsgesellschafter der GmbH sind, hinsichtlich der Kündigungsfristen Arbeitnehmern gleichgestellt (BGH, Urt. v. 29.1.1981 – II ZR 92/80 – sowie v. 26.3.1984 – II ZR 120/83).
Anders nun das BAG, wonach sich die Frist nach den Regelungen für freie Dienstverhältnisse in § 621 BGB richten soll. Für die Dauer der Frist kommt es dabei allein auf die Frage an, nach welchen Zeitabschnitten die Vergütung bemessen ist, also ob z.B. ein Monats- oder Jahresgehalt vereinbart wird, unabhängig von Auszahlungsmodus und Fälligkeit. Dies kann zu großen Unterschieden führen: Im Urteilsfall war ein Jahresgehalt vereinbart, so dass die Kündigung mit einer Frist von sechs Wochen zum Schluss eines Kalendervierteljahres zulässig war (§ 621 Nr. 4 BGB). Dass die Vergütung in zwölf monatlichen Raten zu zahlen war, spielt für die Länge der Kündigungsfrist hingegen keine Rolle. Hätten die Parteien stattdessen eine Monatsvergütung vereinbart, so hätte der Klägerin zum Monatsende gekündigt werden können, sofern die Kündigung spätestens am 15. des Monats zugegangen wäre (§ 621 Nr. 3 BGB).
Sofern der Geschäftsführer nicht behauptet Arbeitnehmer zu sein, sind bei Kündigungsstreitigkeiten regelmäßig nicht die Arbeitsgerichte, sondern die Zivilgerichte zuständig. In der Praxis wird sich daher zeigen müssen, ob sich die Auffassung der BAG-Richter auch dort durchsetzen kann.
Skifahren ist keine Geschäftsführerpflicht
Die Teilnahme eines Geschäftsführers an einer Skiabfahrt im Rahmen einer mehrtätigen Skireise in den USA ist reines Privatvergnügen. Ein dabei erlittener Beinbruch stellt keinen Arbeitsunfall dar und unterliegt nicht der gesetzlichen Unfallversicherung (Urteil des LSG Hessen vom 14.8.2020 – L 9 U 188/18).
Der Geschäftsführer hatte in Absprache mit seiner Arbeitgeberin die Reise selbst geplant, um die Kundenbindung zu intensivieren. Über das gemeinsame Skifahren hinaus war kein weiteres Rahmenprogramm vorgesehen. Der Geschäftsführer stürzte bei der Abfahrt und musste noch in den USA operiert werden.
Zwar sind Angestellte während einer Dienstreise grundsätzlich versichert, allerdings nur soweit sie tatsächlich für den Arbeitgeber tätig sind. Es gibt also keinen Versicherungsschutz „rund um die Uhr“, vielmehr sind betriebliche und rein private Tätigkeiten während der Reise jeweils getrennt zu betrachten.
Das Skifahren sei jedenfalls vorliegend als reine Privatsache des Geschäftsführers zu werten: Skifahren gehöre weder zu seinen Geschäftsführerpflichten, noch habe es eine entsprechende Dienstanweisung seiner Arbeitgeberin gegeben.
Auch die Finanzierung der Reise durch das Unternehmen oder die Pflege geschäftlicher Kontakte änderten nichts an dieser Einordnung – sonst könnten Arbeitgeber und Versicherter schließlich durch entsprechende Reisegestaltung beliebig bestimmen, welche Freizeitaktivitäten Versicherungsschutz genießen.
Außerdem bezweifelte das Gericht bereits, dass es sich bei der Skireise überhaupt um eine Dienstreise handelte. Für reine „Spaßreisen“ – sog. Motivations- und Incentivereisen – bestehe regelmäßig ohnehin kein Versicherungsschutz, da solche Reisen nicht „betriebsdienlich“ seien.
Rohertrag keine taugliche Berechnungsgrundlage für Vertragshändlerausgleich
Für die Berechnung eines Ausgleichsanspruchs nach Vertragsende kann sich der Vertragshändler nur auf den Wert des von ihm geschaffenen Kundenstammes stützen. Der mit dem Produkt erzielte Rohertrag ist dagegen nicht aussagekräftig (BGH, Urteil v. 24.9.2020 – VII ZR 69/19).
Die Klägerin war als Vertragshändlerin für die beklagte Autoimporteurin tätig. Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses verlangte sie von der Beklagten Auskunft über den im letzten Vertragsjahr mit Neukunden erzielten Rohertrag (Erlöse abzüglich der variablen Kosten), um später auf dieser Grundlage einen Ausgleichsanspruch geltend machen zu können.
Der BGH lehnte den Auskunftsanspruch ab: Voraussetzung für den Ausgleich sei, dass die Importeurin aus der Geschäftsverbindung mit von der Klägerin neu geworbenen Kunden oder der Ausweitung bestehender Kundenbeziehungen erhebliche Vorteile habe. Typischerweise bestehen solche Vorteile mindestens im Umfang der entfallenden Einkaufsrabatte des Vertragshändlers. Anhand des Rohertrags aus dem Verkauf von Fahrzeugen und Ersatzteilen könne hingegen keine Aussage über den Wert des geschaffenen Kundenstamms („goodwill“) getroffen werden, sondern allenfalls über die Gewinnmarge der Importeurin. Der BGH kam daher zu dem Ergebnis, dass die Klägerin ihr Auskunftsverlangen auf die falsche Grundlage gestützt hatte.
Die Entscheidung zeigt, wie schwierig es für den Vertragshändler sein kann, seinen Ausgleichsanspruch geltend zu machen. Maßgeblich für die Berechnung sind die Unternehmervorteile. Will der Vertragshändler sich darauf stützen, dass diese die Provisions-/Einkaufsrabattverluste übersteigen, sind hierfür häufig Kenntnisse der internen Unternehmenskalkulation notwendig, die nur mit einem entsprechenden Auskunftsverlangen zu erlangen sind. In der Praxis ist dabei unbedingt auf die sorgfältige Formulierung des Antrags zu achten.
Keine internationale Zuständigkeit deutscher Gerichte bei Flugbuchungen über das Internet
Die bloße Buchung eines Fluges, der weder in Deutschland beginnt oder endet, über die deutschsprachige Internetseite einer ausländischen Fluggesellschaft begründet keine internationale Zuständigkeit deutscher Gerichte. Dies gilt auch dann, wenn die ausländische Fluggesellschaft zwar über eine Niederlassung im Gebiet der Bundesrepublik verfügt, diese jedoch für den Betrieb der Internetseite nicht verantwortlich ist.
Das OLG Frankfurt am Main (Urteil vom 16.1.2020, Az. 16 U 208/18, nicht rechtskräftig) hat entschieden, dass mangels Bezug zum Betrieb der deutschen Niederlassung einer französischen Gesellschaft die deutschen Gerichte nicht international zuständig sind, wenn die betroffene Webseite aus dem Ausland betrieben wird.
Im entschiedenen Fall verlangte ein Kunde Schadensersatz wegen der Stornierung eines First-Class Flugtickets, dass er zu einem sehr günstigen Preis erworben hatte – für ca. 600 € anstatt ca. 10.000 €. Die beklagte Fluggesellschaft stornierte das Ticket bereits einen Tag nach Buchung wegen eines Systemfehlers und erstattete den gezahlten Betrag. Der Kunde verlangte daraufhin Schadensersatz in Höhe des objektiven Flugpreises und führte aus, dass das Landgericht Frankfurt/Main international zuständig sei, da das Ticket auf der Website der deutschen Niederlassung der Beklagten gebucht und in Frankfurt/Main ausgestellt wurde sowie auf dem Ticket unter Kontakt auf eine Telefonnummer mit der Vorwahl „069“ verwiesen wird. Die Beklagte habe zudem durch Angaben im Impressum einen Rechtsschein für den Betrieb der Website aus Deutschland heraus gesetzt.
Das OLG hat entschieden, dass die Zweigniederlassung nicht an dem Rechtsverhältnis zwischen Fluggesellschaft und Fluggast beteiligt war und somit die internationale Zuständigkeit gemäß Art. 7 Nr. 5 EuGVVO (Brüssel Ia) mangels Bezogenheit zum Betrieb der Niederlassung verneint. Die Niederlassung war kein Dienstanbieter iSd Telemediengesetz. Die Mitarbeiter der Niederlassung hatten keine Zugriffsrechte und damit auch keine Möglichkeit, die Inhalte zu verändern, noch wurde die technische Einrichtung zur Speicherung der Website bereitgehalten. All dies fand in Paris am Firmenhauptsitz statt. Das Gericht führte weiter aus, dass auf dem Ticket durch die Angabe „WEB“ klar erkennbar gewesen sei, dass es sich um eine Internetbuchung gehandelt habe. Schließlich betrifft die angegebene Telefonnummer mit der Vorwahl „069“ einen nachvertraglichen Vorgang und hat damit keinen Einfluss auf die Frage nach dem Wo und Wie des Vertragsschlusses. Reine Rechtsscheingesichtspunkte wie etwa Angaben im Impressum vermögen die internationale Zuständigkeit auch nicht zu begründen.
Dies bedeutet, dass die Praxis der Rechtsprechung, im Bereich des Flugreiserechts verbraucherfreundlich einen Gerichtsstand in Nähe des Wohnorts anzunehmen, noch keinen Niederschlag bei reinen Flugbuchungen über das Internet gefunden hat. Dies stellt auch einen großen Unterschied zu Urheberrechtsverletzungen im Internet dar, bei dem für die Zuständigkeit der Gerichte bereits genügt, wenn die Website an einem Ort abgerufen werden kann (z.B. in Frankfurt), selbst wenn die Website sich z.B. an den französischsprachigen Raum wendet.
Abmahnmissbrauch lohnt sich künftig nicht mehr
Am 9.10.2020 hat der Bundesrat das „Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbs“ gebilligt, das umfangreiche Maßnahmen zur Verhinderung missbräuchlicher Massen-Abmahnungen vorsieht.
So werden u.a. finanzielle Fehlanreize für Abmahner beseitigt, indem die Kosten für Abmahnungen wegen Verstößen gegen Informations- und Kennzeichnungspflichten im Internet oder wegen Datenschutzverstößen von Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitern nicht mehr erstattungsfähig sind. Außerdem ist in diesen Fällen die Vereinbarung einer Vertragsstrafe bei erstmaliger Abmahnung nunmehr ausgeschlossen.
Nach den neuen Regelungen sind Mitbewerber anspruchsberechtigt, soweit sie in nicht unerheblichem Maße und nicht nur gelegentlich Waren oder Dienstleistungen vertreiben oder nachfragen. Bloße Scheinunternehmen und bereits insolvente Mitbewerber können damit künftig keine Abmahnungen mehr aussprechen. Wirtschaftsverbände müssen sich in eine Liste qualifizierter Wirtschaftsverbände eintragen lassen – nur dann sind sie zur Geltendmachung von Ansprüchen berechtigt.
Das Gesetz sieht darüber hinaus Erleichterungen für den Abgemahnten vor: Anhand eines Katalogs von Regelbeispielen für eine missbräuchliche Geltendmachung von Ansprüchen sollen sich missbräuchliche Abmahnungen künftig leichter darlegen und beweisen lassen. Der zu Unrecht Abgemahnte hat außerdem einen Gegenanspruch auf Ersatz seiner Rechtsanwaltskosten.
Millionen-Bußgeld gegen Telekommunikationsdienstleister zu hoch!
Zu diesem Ergebnis kam das LG Bonn in seinem Urteil vom 11.11.2020 (29 OWi 1/20 LG) und setzte das ursprünglich vom Bundesdatenschutzbeauftragten in Höhe von 9,55 Millionen € verhängte Bußgeld auf 900.000 € herab.
Anstoß für das Verfahren war eine Strafanzeige eines Kunden des Telekommunikationsdienstleisters gegen seine ehemalige Lebensgefährtin. Diese hatte sich über das Callcenter des Telekommunikationsdienstleisters seine aktuelle Telefonnummer besorgt und ihn telefonisch belästigt. Sie hatte sich gegenüber der Callcenter-Mitarbeiterin nur mit dem Namen und dem Geburtsdatum des Kunden legitimieren müssen. Der Bundesdatenschutzbeauftragte sah darin einen grob fahrlässigen Verstoß des Telekommunikationsdienstleisters gegen die Pflicht zum Einsatz geeigneter technischer und organisatorischer Datenschutzmaßnahmen.
Das Gericht gab dem Bundesdatenschutzbeauftragten in der Sache Recht und bejahte einen Verstoß. Die Kundendaten seien nicht durch ein ausreichendes Authentifizierungsverfahren geschützt gewesen. Allerdings liege nur ein geringes Verschulden vor, da der Verstoß nicht zur massenhaften Herausgabe von Daten an Nichtberechtigte führen konnte.
Wie das Gericht selbst feststellte, fehlt es derzeit an verbindlichen Vorgaben für die Legitimierung bei Anrufen in Callcentern. Unternehmen sind dennoch angehalten, entsprechende Prozesse zu entwickeln, die eine Weitergabe von Daten an unberechtigte Dritte verhindern – ggf. auch in Abstimmung mit der zuständigen Datenschutzbehörde.